Wie ist die Aktivität von Genen untereinander verschaltet? Und wie wirken sich genetische Änderungen und Umwelteinflüsse auf das Zusammenspiel aus? Mit Hochdurchsatz-Analysen und statistischen Modellen möchten Michael Boutros und Oliver Stegle diesen Fragen auf den Grund gehen.
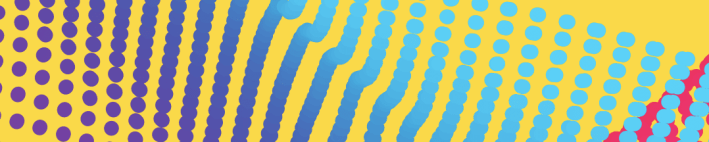
Quelle: Einblick 2/2020 Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Stefanie Reinberger
Es ist eine chaotische Kakophonie: Zwar sitzen alle Orchestermitglieder einsatzbereit an ihrem Platz, doch statt wohltönender Musik wabert ein undefinierbarer Klangteppich durch den Saal. Kurz vor Konzertbeginn entlockt jeder Musiker seinem Instrument schnell noch ein paar Töne. Erst in dem Moment, in dem der Dirigent seinen Taktstock hebt, nimmt das Ganze Form und Struktur an. Jeder Instrumentalist spielt seinen Teil des Gesamtwerks: im richtigen Moment, die richtigen Noten; mal lauter, mal leiser, im abgestimmten Tempo. So wird aus einer Vielzahl unterschiedlicher Töne schließlich Musik. Ähnlich einer Orchestersuite, folgt auch das Leben einer ausgefeilten Partitur. Jede einzelne Zelle im Organismus übernimmt die für sie bestimmte Aufgabe. Ihre individuelle Identität erhält sie dabei durch das präzise Zusammenspiel ihrer Gene – genauer gesagt durch die exakt aufeinander abgestimmte Aktivität der Gene. „Hinter all dem stecken ausgeklügelte Schaltpläne, denn viele Gene beeinflussen sich gegenseitig in ihrer Aktivität und Wirkweise“, erklärt Michael Boutros, Leiter der Abteilung Signalwege und Funktionelle Genomik im DKFZ. „Die Schaltpläne steuern das Zusammenspiel der Gene und entscheiden so darüber, ob sich eine heranreifende Zelle letztlich zur Nervenzelle oder zum Blutkörperchen entwickelt – und das bei weitestgehend identischem Erbgut.“
Auch ob eine Zelle gesund ist und ihre vorgesehene Aufgabe erfüllt, oder ob sie beispielsweise beginnt, sich als Krebszelle unkontrolliert zu vermehren, hängt vom Miteinander der Gene ab. Wie Schaltpläne aussehen können, nach denen das Konzert des Lebens spielt, haben Wissenschaftler in der Vergangenheit bei Einzellern wie Hefezellen erforscht. Doch was bei solch einfachen Organismen noch halbwegs übersichtlich sein mag, wird bei komplexeren Lebewesen zu einer enormen Herausforderung. So besteht etwa der Körper eines 70 Kilogramm schweren Mannes aus rund 30 Billionen Zellen, die vielen verschiedenen Aufgaben nachkommen und dementsprechend auch über sehr unterschiedliche Schaltpläne verfügen müssen. Kaum vorstellbar, wie es gelingen soll, hier den Überblick zu behalten.
Michael Boutros hat sich gemeinsam mit Oliver Stegle, Leiter der Abteilung Bioinformatik der Genomik und Systemgenetik, sowie Kooperationspartnern des European Molecular Biology Laboratory (EMBL) und der Universität Heidelberg ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Sie wollen im Rahmen eines vom Europäischen Forschungsrat ERC geförderten Projektes Prinzipien von genetischen Schaltplänen höherer Organismen entschlüsseln und verstehen, wie sich diese im Laufe der Entwicklung verändern oder auf Umwelteinflüsse reagieren. Sie widmen sich dabei unter anderem dem Darmgewebe eines Modellorganismus, der sich in den genetischen Laboren der Welt bereits seit vielen Jahren großer Beliebtheit erfreut: die Taufliege Drosophila melanogaster. Die Fliege hat den Vorteil, dass sie molekularbiologisch bereits sehr gut untersucht ist – ein guter Ausgangspunkt, um tiefergehende Fragestellungen zu bearbeiten.
Eines der wichtigsten Werkzeuge für das Unterfangen ist die Genschere CRISPR/Cas9, mit der sich einzelne Gene ausschneiden und so aus dem Erbgut entfernen lassen. Im nächsten Schritt können die Wissenschaftler dann untersuchen, welche Konsequenzen das Fehlen des betreffenden Gens hat. Wie beeinflusst der Verlust den Schaltplan des kompletten Systems? Dieses Prozedere wollen die Wissenschaftler für hunderte Gene durchspielen, die sie einzeln oder auch paarweise ausschneiden. Doch es wird noch kniffliger: „Wir sind heute in der Lage, die Genaktivität in einzelnen Zellen zu untersuchen“, sagt Boutros. „Auf diese Weise können wir beobachten, welchen Effekt unser Eingriff auf das Zusammenspiel der Gene in einer einzelnen Zelle hat.“ Das ist entscheidend, denn ein Gewebe – egal ob im gesunden Organ oder in einem Tumor – ist in der Regel sehr heterogen. Das heißt, es besteht aus einem Gemisch aus Zellen mit sehr individuellen Eigenschaften, weil sie zum Beispiel unterschiedliche Aufgaben erfüllen müssen, weil sie sich in einem unterschiedlichen Entwicklungsstadium befinden oder an einem anderen Punkt im Zellzyklus.
Durch den Blick in einzelne Zellen möchten die Wissenschaftler zur Grundlage des Geschehens vordringen: Welche unmittelbaren Folgen hat zum Beispiel eine Genmutation oder die Gabe eines Medikaments? „Wenn wir die nach außen sichtbaren Effekte einer Veränderung beobachten, also ob die Zellen etwa zugrunde gehen, ob sie anfangen sich zu teilen oder neue Eigenschaften zu entwickeln, setzen wir zu spät an“, erklärt Boutros. „Das sind oftmals spätere Folgen, die das Gesamtgeschehen nach sich zieht.“ Um zum Bild des Orchesters zurückzukommen: Wenn die Flöte patzt, sind vielleicht zunächst nur die benachbarten Holzbläser irritiert. Das ist die direkte Folge. Doch bis das gesamte Orchester aus dem Takt kommt, muss sich der Fehler durch viele weitere Instrumentengruppen fortsetzen.Tausende von Genen und deren Effekte auf Einzelzellbasis analysieren – es braucht nicht viel mathematisches Geschick, um sich vorzustellen, dass hier Unmengen an Daten anfallen, die analysiert werden wollen. Denn die Masse an experimentellen Ergebnissen allein erlaubt ja noch keine Aussage. Man muss sie auch verstehen und interpretieren können. An dieser Stelle kommt Oliver Stegle ins Spiel. Er entwickelt mit seinem Team Methoden, um solche Hochdurchsatzdaten analysieren zu können. Dabei geht es um Statistik, aber auch sehr viel um maschinelles Lernen und Mustererkennung: Welche Effekte im System gehen direkt auf eine bestimmte Veränderung im Erbgut zurück? Was ist möglicherweise „Hintergrundrauschen“, also Nebeneffekte, die durch das experimentelle Vorgehen bedingt sind?Der Aufwand lohnt sich, davon ist Stegle überzeugt. „Zunächst geht es uns vorrangig darum, die geeigneten Werkzeuge zu entwickeln, um solche Daten zu analysieren und biologische Einsichten zu gewinnen. Wir möchten ihnen Aussagen entlocken, wie sich unterschiedliche Genvarianten und das Maß, in dem sie aktiv sind, auf andere Gene und schlussendlich auf die Eigenschaften einer Zelle auswirken“, erklärt der Wissenschaftler. „Diese Werkzeuge ebnen den Weg, um dann vergleichbare Studien auch mit menschlichen Zellen durchzuführen. Beispielsweise um zu verstehen, welche Störungen im Schaltplan bei Krebs eine Rolle spielen und wie Medikamente in das Geschehen eingreifen.“ Das eröffne letztlich ganz neue Möglichkeiten für die Entwicklung neuer Wirkstoffe. Die Datenwerkzeuge sollen auch dabei helfen, zu verstehen, warum eine Therapie bei manchen Patienten wirkt und bei anderen nicht. Oder wie Resistenzen entstehen und weshalb manchmal auch nach vielen Jahren eine Krebserkrankung nochmals zuschlägt – lange nachdem man dachte, sie besiegt zu haben.
In einem weiteren Forschungsprojekt untersuchen die Wissenschaftler die genetischen Schaltpläne in sogenannten Organoiden, also Mini-Organen, die sie aus Darmzellen von Patienten und gesunden Probanden in der Kulturschale züchten. „Bei den Organoiden verfolgen wir außerdem einen Multi-Omics Ansatz, das heißt, wir ziehen auch Daten aus umfassenden Analysen anderer Molekülgruppen hinzu. Neben den Genen und ihrer Aktivität interessiert uns beispielsweise auch, welche Proteine in den Zellen vorhanden sind und in welchem Zustand sie sich befinden.“Das bedeutet noch größere Datenmengen, die es sinnvoll zu verarbeiten und zu analysieren gilt. Diese Fülle von Informationen können einzelne Forschergruppen gar nicht mehr alleine bewältigen. Um Omics-Daten bestmöglich auswerten und interpretieren zu können, müssen sie immer häufiger auch mit internationalen Partnern geteilt werden. Wie sich der enorme Datenschatz dann sinnvoll ausschöpfen lässt, ist ein Thema, das Oliver Stegle besonders am Herzen liegt. Er ist Sprecher und Co-Direktor des Deutschen Genom-Phänom-Archivs (GHGA), das vom DKFZ gemeinsam mit der Universität Tübingen initiiert wurde und an dem Wissenschaftler aus mehr als 20 Forschungsinstitutionen in Deutschland mitwirken. „Das Ziel des GHGA ist, die in Deutschland gewonnenen Omics-Daten besser nutzbar und zugänglich zu machen – für andere Forschergruppen im Land, aber auch international“, sagt Stegle. Dafür gilt es eine Infrastruktur aufzubauen, die den Austausch technisch möglich macht und dabei rechtliche und ethische Aspekte berücksichtigt. „Das stärkt nicht nur die Forschung in diesem Feld, sondern hilft auch, eine Brücke zwischen der Grundlagenforschung und einer späteren Anwendung zu schlagen.“
Denn je besser es Forschern gelingt, Zusammenhänge aus ihren riesigen Datensätzen herauszulesen, desto besser sind sie in der Lage, die Partitur des Lebens zu verstehen – ähnlich einem Dirigenten, der den Notensatz sämtlicher Orchestermitglieder überblicken muss. Und vielleicht finden Mediziner dadurch eines Tages die Schlüsselstellen, an denen sie drehen können, um zum Beispiel bei einer Krebserkrankung dem aus dem Takt geratenen „Orchester“ wieder zu einem harmonischen Zusammenspiel zu verhelfen.